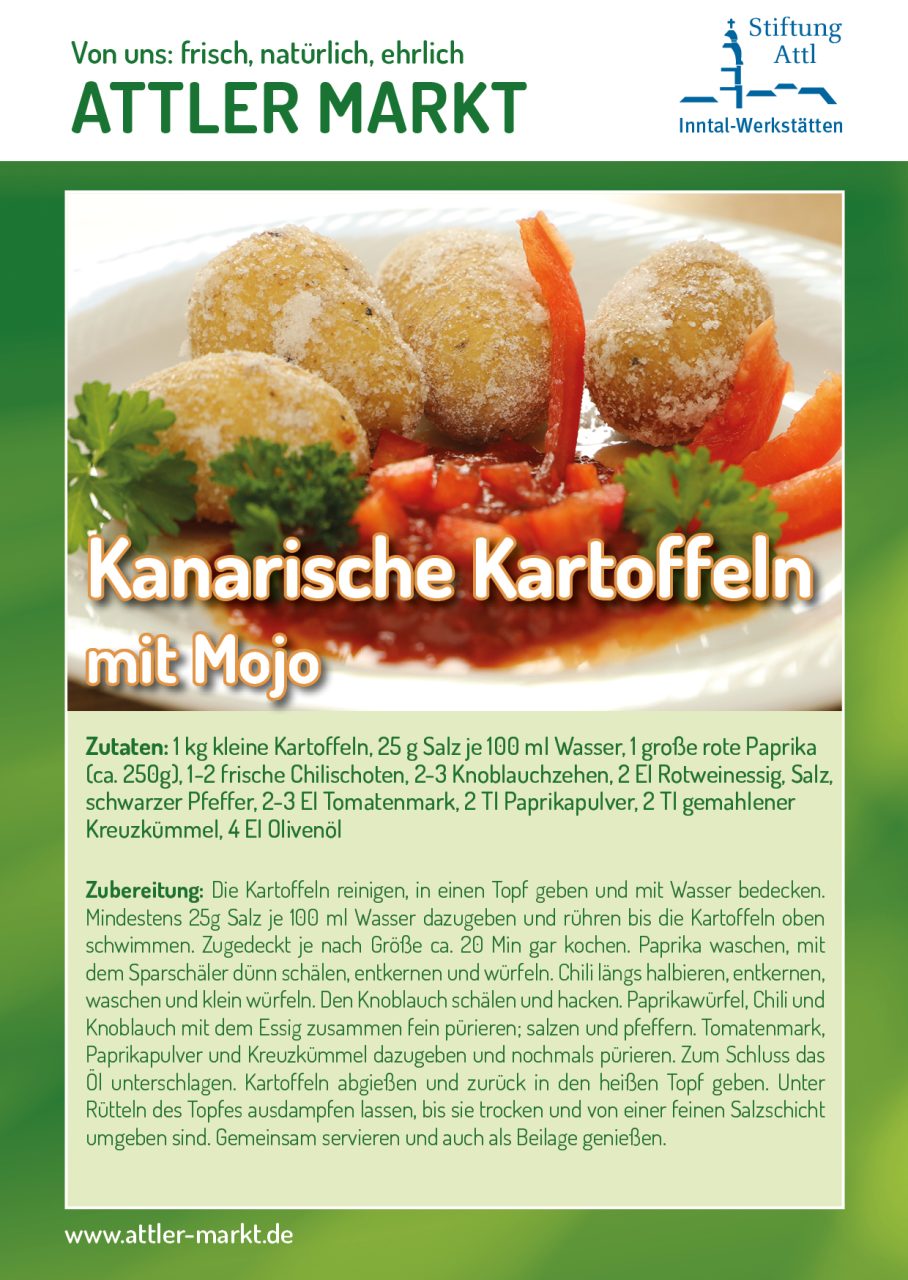Die Attler Obstpresse ist wieder in Betrieb. Jeder, der beispielsweise Äpfel, Birnen oder Weintrauben im heimischen Garten erntet, kann den Service des Attler Hofs in Anspruch nehmen. Termine können ab dem 5. August telefonisch unter der Nummer 08071 / 102 – 272 angefragt werden. Bei einem Anruf erreichen Kunden wie gewohnt einen Anrufbeantworter; die Mitarbeiter des Attler Hofs rufen dann zurück und vereinbaren einen Termin.
Um längere Wartezeiten an der Obstpresse zu vermeiden, bitten die Mitarbeitenden am Attler Hof, die Termine pünktlich wahrzunehmen und das Obst möglichst sauber anzuliefern. Gepresst wird, je nach Bedarf, bis voraussichtlich Mitte November.
Trotz der hohen Energiekosten halten die Attler Landwirte die Preise stabil auf Vorjahresniveau. Für Kunden fallen unverändert 0,60 Euro für einen Liter Süßmost an. Abgefüllt wird ausschließlich in die vom Attler Hof bereitgestellten 5- oder 10-Liter-Beutel. Der 5-Liter-Beutel liegt bei 1,40 Euro, der 10-Liter-Beutel bei 1,80 Euro pro Stück. Die Kartons belaufen sich auf 1,40 bzw. auf 1,80 Euro.
Eine Flaschenabfüllung ist nach vorheriger Absprache möglich. Am besten gleich bei der Terminvereinbarung mit angeben.